This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Geschichte und Einflüsse der minimalistischen Architektur
Minimalistische Architektur hat ihren Ursprung in der Suche nach Einfachheit und Klarheit in der gebauten Umwelt. Sie entspringt dem Wunsch nach Reduktion auf das Wesentliche und beeinflusst seit Jahrzehnten das architektonische Denken und Handeln weltweit. Die Geschichte der minimalistischen Architektur ist eng mit kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen verbunden und spiegelt den Wandel ästhetischer Ideale wider. In dieser Abhandlung werden die Wurzeln, treibenden Einflüsse, grundlegenden Prinzipien und bedeutenden Persönlichkeiten des Minimalismus in der Architektur beleuchtet. Es wird verdeutlicht, wie sich diese architektonische Strömung entwickelte, wie sie von globalen Traditionen geprägt wurde und welche Rolle sie im zeitgenössischen Kontext einnimmt.

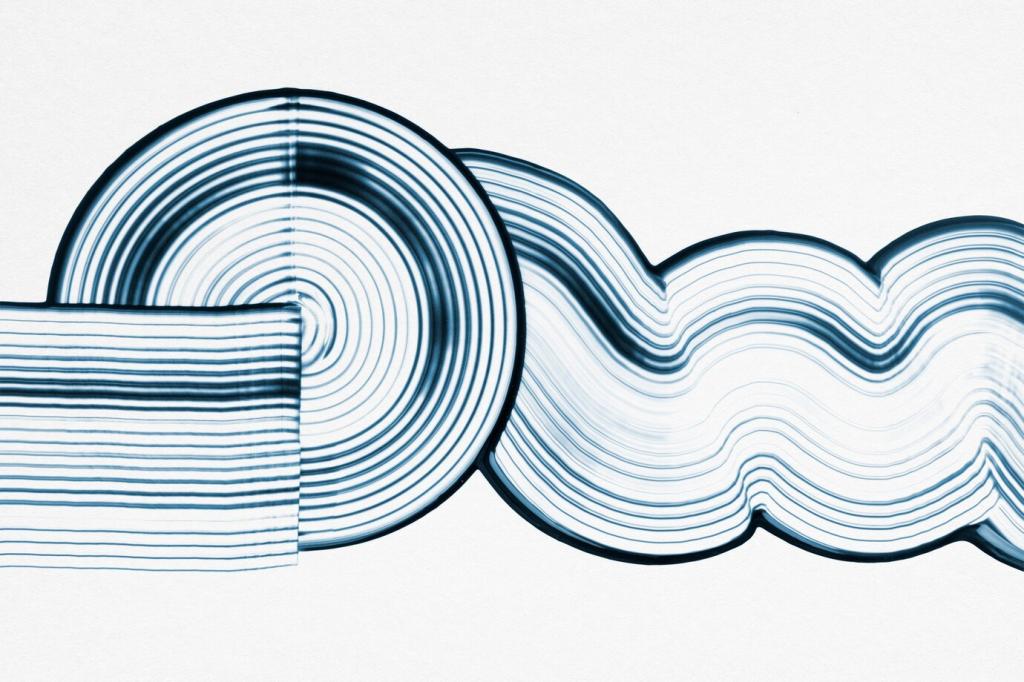

Philosophische Grundlagen des Minimalismus
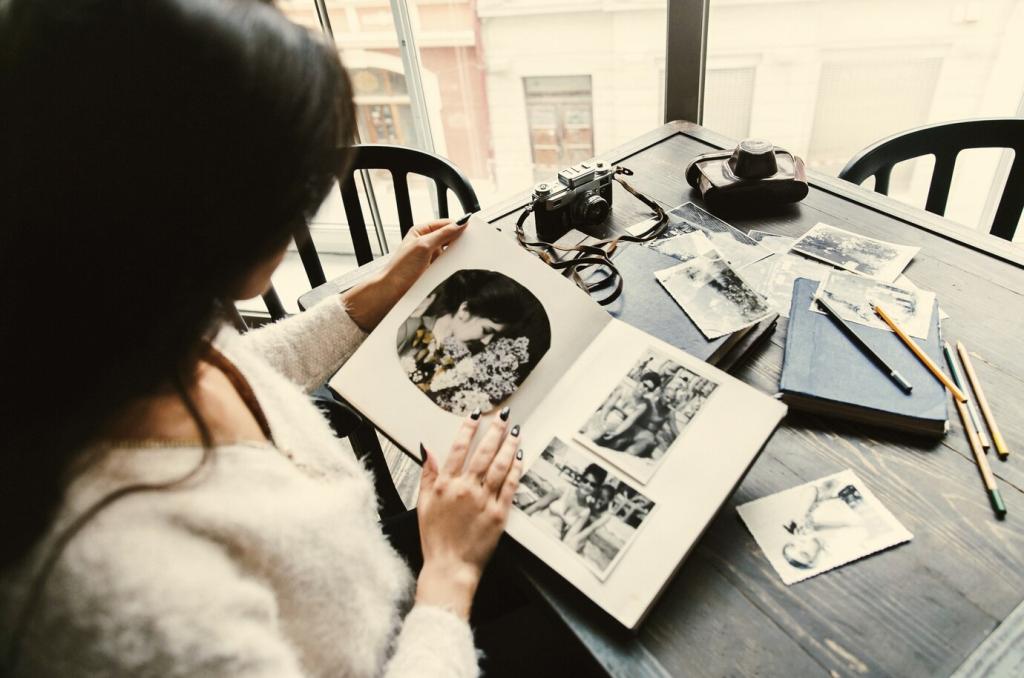
Schlüsselpersönlichkeiten im minimalistischen Bauen

Materialwahl im minimalistischen Kontext
Sichtbeton als Ausdruck von Einfachheit
Glas und Transparenz
Holz zwischen Tradition und Moderne

Minimalistische Architektur im urbanen Kontext
Wohnen in reduzierten Wohnformen
Minimalistische Büroarchitektur
Öffentliche Bauten und Minimalismus
Wahrnehmung und Wirkungminimalistischer Bauten


